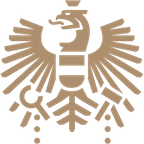Navigation

Inhalt
UVP-G 2000: Zur Definition eines „geschlossenen Siedlungsgebiets“
Ro 2024/04/0009 vom 20. August 2025
Der vorliegende Fall betrifft die geplante Errichtung eines Hotels in einer burgenländischen Gemeinde. Mit Bescheid stellte die Burgenländische Landesregierung fest, dass für dieses Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im vereinfachten Verfahren durchzuführen sei.
Der Projektwerber erhob dagegen eine Beschwerde, der das zuständige Bundesverwaltungsgericht stattgab. Das Gericht stellte fest, dass dieses Vorhaben keiner Pflicht zur Durchführung einer UVP unterliege. Zwar würde das geplante Hotel aufgrund seiner Bettenanzahl den Schwellenwert des Anhangs zum UVP‑Gesetzes 2000 (UVP‑G 2000) erreichen. Unter Berücksichtigung der Umgebung des Vorhabens kam das Gericht jedoch zur Ansicht, dass das Vorhaben innerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebiets liege, weshalb keine UVP durchzuführen sei.
Die Burgenländische Landesregierung erhob eine Amtsrevision.
Der VwGH setzte sich mit dem Begriff des „geschlossenen Siedlungsgebiets“ im Sinne des Anhangs 1 Z 20 lit. a UVP-G 2000 auseinander.
Dazu hielt er allgemein fest, dass hinsichtlich der Frage, ob ein Vorhaben unter den Anhang fällt, das Vorhaben auf Basis der Projektunterlagen sowie die Zielsetzungen des UVP‑G 2000 maßgeblich sind. Mit dem UVP‑G 2000 wurde die UVP‑Richtlinie umgesetzt, weshalb das Gesetz richtlinienkonform auszulegen ist. Der EuGH hat bereits ausgesprochen, dass die UVP‑Richtlinie einen großen Anwendungsbereich und einen weitreichenden Zweck hat.
Die Richtlinie sowie das Gesetz unterscheiden dahingehend, ob ein Beherbergungsvorhaben (hier: Hotel) innerhalb oder außerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebiets liegt. Innerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebiets ist keine UVP durchzuführen. Es kann nämlich in einem solchen Gebiet davon ausgegangen werden, dass aufgrund der bereits vorhandenen Infrastruktur bei Umsetzung eines Beherbergungsvorhabens die Umweltauswirkungen, insbesondere hinsichtlich Verkehr, Abfall und Abwässer, nicht (mehr) erheblich sein werden.
Unter Verweis auf Rechtsprechung des damaligen Umweltsenats führte der VwGH aus, dass sich ein geschlossenes Siedlungsgebiet durch eine zusammenhängende Verbauung auszeichnet, wobei als Teil der Verbauung auch etwa Parks oder andere kommunale Einrichtungen anzusehen sind. Ebenso ist nicht nur auf die unmittelbar angrenzenden Grundstücke abzustellen, nicht jede kleine freie Fläche unterbricht die Geschlossenheit eines Siedlungsgebiets. Unter Berücksichtigung des Regelungszwecks der UVP‑Richtlinie ist aber umgekehrt bei größeren Freiflächen oder Baulücken sowie bei Angrenzen des Projektgrundstücks an unbebaute Flächen in der Regel von keinem geschlossenen Siedlungsgebiet auszugehen. Ein geschlossenes Siedlungsgebiet grenzt sich auch optisch von seiner Umgebung ab, daher ist auch das Landschaftsbild für die Beurteilung relevant.
Schließlich stellte der VwGH klar, dass bei der Prüfung, ob ein Vorhaben innerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebiets liegt, die tatsächlich wahrnehmbaren Umstände entscheidend sind. Etwaigen Flächenwidmungen unbebauter Flächen kann daher höchstens eine Indizwirkung zukommen.
Im vorliegenden Fall hat das Bundesverwaltungsgericht zu Unrecht angenommen, dass das Vorhaben innerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebiets liegt, weshalb der VwGH die Entscheidung aufhob.