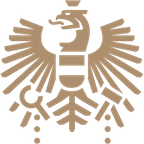Navigation

Inhalt
Beamtendienstrecht: Zählt die Zeit des Umkleidens und Ausrüstens zur Dienstzeit?
Ro 2023/12/0057 vom 15. September 2025
Im vorliegenden Fall beantragte ein mittlerweile im Ruhestand befindlicher Exekutivbeamter bei seiner Dienststelle (Landespolizeidirektion Wien) im Wesentlichen die Anerkennung der Zeiten des Umkleidens (An- und Ablegen der Uniform) und des Ausrüstens („Umkleide- und Rüstzeit“) als Dienstzeit sowie die Abgeltung dieser Zeiten als Überstunden.
Die Landespolizeidirektion Wien wies den Antrag mit Bescheid ab. Die Behörde ging davon aus, dass keine gesetzliche Grundlage bestehe, um Umkleide- und Rüstzeiten als Dienstzeiten anzuerkennen. Darüber hinaus würden besondere Belastungen oder Aufwendungen eines Beamten durch Zulagen abgegolten.
Der Polizist wandte sich gegen die Entscheidung der Behörde mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht, das die Beschwerde jedoch abwies. Auch das Verwaltungsgericht ging davon aus, dass Umkleide- und Rüstzeiten nicht als Dienstzeiten gelten.
Gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts erhob der Beamte Revision an den VwGH.
Der VwGH setzte sich mit der Frage auseinander, ob Vor- und Nachbereitungshandlungen (wie etwa hier: Anlegen der Uniform und Ausrüstung – „Umkleide-“ bzw. „Rüstzeit“) zur Dienstzeit zählen.
Dazu verwies er auf das Unionsrecht und die dazu ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. Demnach gibt es keine Zwischenkategorie zwischen (sich einander ausschließenden) Arbeitszeiten und Ruhezeiten.
Zur Frage, ob eine Zeit „Arbeitszeit“ darstellt, stellte der EuGH Kriterien zu den drei Bestandteilen des unionsrechtlichen Begriffs „Arbeitszeit“ auf.
Der erste Bestandteil, wonach der Arbeitnehmer arbeiten muss, ist räumlich zu verstehen. Dies umfasst die Pflicht, an einem bestimmten Ort zu arbeiten oder auch sich im Rahmen einer Rufbereitschaft bereit zu halten. Bei Arbeitnehmern ohne festen Arbeitsort können auch Fahrzeiten dazu zählen.
Zweiter Bestandteil ist die Pflicht des Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen. Zur Verfügung steht ein Arbeitnehmer dann, wenn er Anweisungen des Arbeitgebers Folge leisten und seine Tätigkeit für ihn ausführen kann (und daher nicht frei über seine Zeit verfügen kann).
Schließlich umfasst der dritte Bestandteil die Pflicht des Arbeitnehmers, seine Tätigkeit auszuüben oder seine Aufgaben wahrzunehmen. Auch darunter fallen etwa notwendige Fahrzeiten von Arbeitnehmern ohne festen Arbeitsort zwischen dem Wohnort und den von ihnen betreuten Kunden, etwa für eine Wartung vor Ort (die die eigentliche Arbeit darstellt).
Der Oberste Gerichtshof sprach bereits aus, dass auch die Umkleidezeit von Krankenpflegepersonal (neben der „Kernarbeit“) zur Arbeitszeit zählt.
Vor diesem Hintergrund zählen daher auch Vor- und Nachbereitungshandlungen wie in dem vom VwGH zu beurteilenden Fall - bei Vorliegen der unionsrechtlich gebotenen Kriterien - zur Dienstzeit eines Exekutivbeamten. Die Qualifikation bloß der „Kernarbeit“ als Dienstzeit widerspricht dem Unionsrecht .
Da das Bundesverwaltungsgericht den Fall nicht anhand der dargestellten Rechtsprechung des EuGH geprüft hat, hob der VwGH die angefochtene Entscheidung auf.