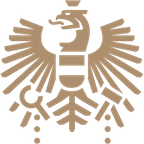Navigation

Inhalt
Datenschutz: Dürfen Meldedaten für eine Bürgerumfrage verwendet werden?
Ra 2021/04/0118 vom 30. April 2025
Im vorliegenden Fall beabsichtigte die Stadt Wels eine Bürgerbefragung durchzuführen. Dazu veröffentlichte sie zunächst Informationen und den dazugehörigen Fragebogen im Amtsblatt. Darüber hinaus versandte der Bürgermeister der Stadt Wels namentlich adressiert die Informationen und den Fragebogen an die Bürger der Stadt. Die Daten stammten aus dem Melderegister. Ein Bürger erachtete sich dadurch in seinem Recht auf Geheimhaltung seiner Daten verletzt und erstattete eine Datenschutzbeschwerde an die Datenschutzbehörde.
Die Datenschutzbehörde gab der Datenschutzbeschwerde statt und stellte fest, dass durch die Verwendung der Meldedaten das Recht auf Geheimhaltung verletzt wurde. Es habe für die Verwendung der Daten keine gesetzliche Grundlage bestanden.
Eine vom Bürgermeister dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit einer Maßgabe abgewiesen. Das Gericht ging im Wesentlichen davon aus, dass es andere Möglichkeiten der Teilnahme (etwa in Form einer freiwilligen Anmeldung) gegeben und es somit einer postalischen Versendung des Fragebogens nicht bedurft hätte. So sei nicht das gelindeste Mittel für einen Eingriff in die Geheimhaltungsinteressen gewählt worden, weshalb bereits deshalb keine gesetzliche Deckung für die Verarbeitung in den in Frage kommenden Bestimmungen gefunden werden könne.
Der Bürgermeister wandte sich schließlich mit einer Revision an den VwGH.
Der VwGH setzte sich mit der Frage auseinander, ob Meldedaten im Rahmen einer Bürgerumfrage zur Kontaktaufnahme mit den Bürgern benützt werden dürften.
Zunächst stellte der VwGH klar, dass es sich um einen vor dem Inkrafttreten der DSGVO (25. Mai 2018) abgeschlossenen Vorgang handelt, weshalb die alte Rechtslage des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000) zur Anwendung kommt.
Auch das DSG 2000 sieht vor, dass Daten nur dann verwendet werden dürfen, wenn dafür eine gesetzliche Zuständigkeit oder rechtliche Befugnisse bestehen und die Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen nicht verletzt werden (§ 7 Abs. 1). Dieser Eingriff muss verhältnismäßig sein (§ 7 Abs. 3).
Nach § 8 Abs. 1 Z 1 DSG 2000 sind Geheimhaltungsinteressen bei Verwendung nicht-sensibler Daten dann nicht verletzt, wenn für die Verwendung eine gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung besteht.
Das Meldegesetz ermächtigt Bürgermeister (ungeachtet, ob sie auch Meldebehörden sind) Meldedaten zu verarbeiten, wenn dies zur Wahrnehmung ihrer gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bildet.
Im vorliegenden Fall findet sich eine solche gesetzliche Grundlage in § 70 des Stadtstatuts der Stadt Wels. Diese Bestimmung trägt der Stadt auf, ihre Einwohner über bestimmte Vorhaben im Vorfeld zu informieren. Dies hat durch Anschlag an der Amtstafel aber auch in anderer wirksamer Weise so zu erfolgen, dass alle Einwohner umfassend erreicht werden (etwa Aussendungen oder in der Presse).
Zu der Frage der Verhältnismäßigkeit der Aussendungen hielt der VwGH unter Verweis auf seine Rechtsprechung fest, dass sich eine Verarbeitung auch dann als erforderlich erweisen kann, wenn damit die im öffentlichen Interesse stehenden Aufgaben des Verantwortlichen (hier: des Bürgermeisters) effizient(er) erfüllt werden können.
Die im vorliegenden Fall erfolgte Versendung des Fragebogens kann daher deshalb als erforderlich angesehen werden, weil dadurch eine erleichterte sowie größere Teilnahme an der Umfrage erreicht werden sollte. Eine freiwillige Anmeldung hätte eine höhere Zugangsschwelle dargestellt.
Der VwGH hob die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts auf.